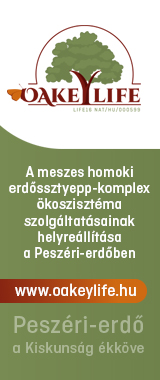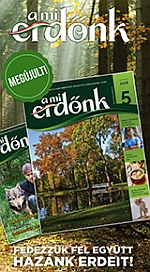|
Ein großer Anteil der von unserer Gesellschaft bearbeiteten Waldgebiete ist infolge der Eigenheiten der Standorte auf dem Donau-Theiß-Zwischenstromland künstlich angelegt, doch wir sind bemüht, den Anteil der
einheimischen Arten in den natürlichen Pflanzengemeinschaften unter Berücksichtigung des Standortes maximal zu erhöhen.
In den von uns bewirtschafteten staatlichen Wäldern entsteht eine Walderneuerungspflicht jährlich nach der Endnutzung auf durchschnittlich 1200-1300 ha.
75% der Zielbestände sind in der ersten Ausführung der Erneuerungen Laubbäume, 25% machen Nadelbäume aus. Die Beforstung durch Wurzelschösslinge wird in 30% angewandt, 70% der künstlichen Walderneuerung erfolgt nach vollständiger Bodenvorbereitung.
63% der ersten Ausführung der Verjüngung besteht in Jahresdurchschnitt aus einheimischen Baumarten, vor allem wird Weißpappel gepflanzt. Innerhalb der künstlichen Verjüngungen beträgt der Beforstungsanteil durch Weißpappel 63%, während der restliche Anteil - 37% - mit Nadelbäumen bepflanzt wird. Bevorzugt ist die erste Ausführung der Beforstung durch einheimische Baumarten, wenn aber diese infolge extremer Standortverhältnisse nicht möglich ist, so werden Nadelbaumarten, die zwar nicht einheimisch, jedoch anspruchsloser sind, angepflanzt.
Bei den Walderneuerungen sind wir weitestgehend bemüht, die Grundsätze der erweiterten Reproduktion zur Geltung zu bringen. Wir sind bestrebt, auf den von Endnutzung betroffenen Gebieten einen noch hochwertigeren Wald entstehen zu lassen. Bei den künstlichen Walderneuerungen möchten wir den Anteil der Laubbäume in der ersten Verjüngung erhöhen, denn dadurch kann auch die Größe der Waldgebiete mit einheimischen Bäumen erweitert werden (Bewaldung mit einheimischen Pappeln). Auch bei Beforstung durch Nadelbäume achten wir auf die Mischung der Baumarten, um die Eintönigkeit der Monokulturen zu mindern.
|

|